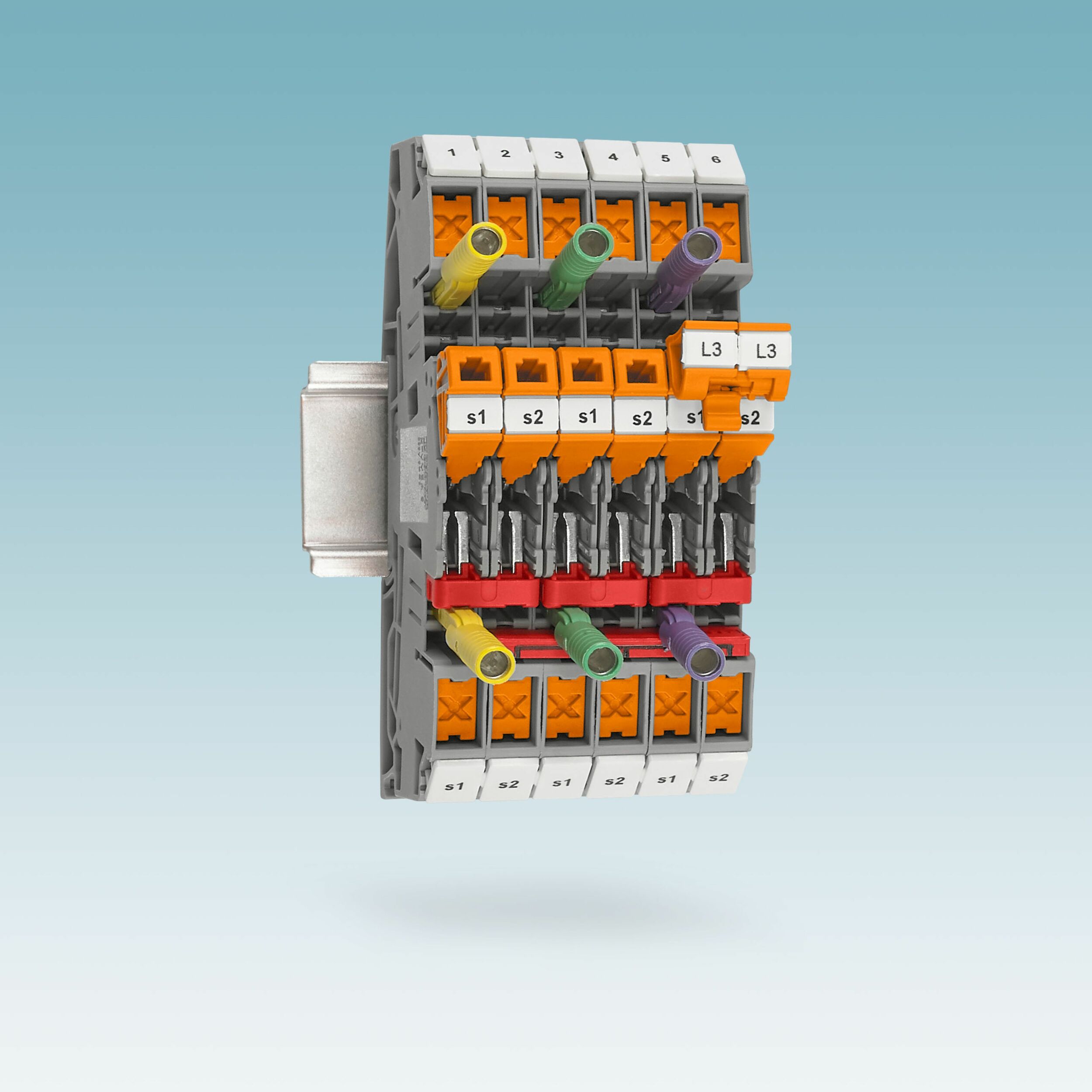Ein kleiner Störer kann schlimmstenfalls zum Ausfall des gesamten Systems führen. Um teure Produktionsausfälle zu vermeiden, müssen daher in der automatisierten Fabrik am besten schon in der Planungsphase Störströme verhindert werden. Eine Herausforderung, denn in der Smart Factory steigt die Leistungs- und Datendichte immer weiter an. Die Verwaltung oder Steuerung erfolgt durch Frequenzumrichter, Transformatoren, elektrische Schalter und Kommunikationsgeräte. Je mehr Komponenten beteiligt sind, desto größer ist das Risiko von Störungen. Gleichzeitig werden die Bauräume in Maschinen und Anlagen immer kleiner. Vor allem dort, wo viele starke Antriebe mit sind ändernden magnetischen Feldern und Wechselrichtern im Einsatz sind, ist die Gefahr der Störung einer Datenleitung besonders groß.
Kabeldesign neu gedacht
Wie Störungen innerhalb von Verbindungslösungen nahezu eliminiert werden können, hat Lapp gerade im Rahmen des Pepa-Forschungsprojektes des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz unter Beweis gestellt. Neben Lapp sind an dem Projekt die Firmen SEW-Eurodrive, Block, Danfoss, Magnetec und die Technische Universität Darmstadt beteiligt. Hier führt Lapp das Arbeitspaket 4: „Kopplungen zwischen benachbarten Leitungen sowie mit Anlagenteilen. Messungen und Optimierungen der Kabelkonstruktion“. Dessen Ziel ist es, eine firmenübergreifende Forschung an einem komplexen Thema aus der Automatisierungs-/Antriebswelt, bei dem es insbesondere auf die korrekte Auswahl der Verbindungskomponenten sowie der fachgerechten Installation dieser ankommt, zu forcieren. Der Hintergrund der Untersuchung besteht darin, dass es in Industrieanlagen, in denen Frequenzumrichter-gesteuerte Motoren eingesetzt werden, vermehrt zu unerwünschten Strömen auf den Potentialausgleichsleitungen (PA) oder Schutzerdleitungen (PE) kommt. Durch die getaktete Ansteuerung (Pulsweiten-Modulation) werden Störströme im Bereich von rund 3kHz bis 500kHz angeregt, welche über Gehäuseteile, PA-/PE-Leiter/-Netze und im schlimmsten Fall über die Schirmung von Datenleitungen in Richtung Erdpotential beziehungsweise zur Quelle abfließen. Hochfrequente Ausgleichströme mit einer Amplitude von 10A oder mehr sind hierbei keine Seltenheit. Die Folgen sind unzulässig hohe Ströme auf der Schutzerde und dadurch vermeintlich fehlerhaft auslösende FI-Schutzschalter (RCD) oder Beeinträchtigung der Datenkommunikation, wenn beispielsweise die Ausgleichsströme über den Kupferschirm einer Datenleitung fließen. Diese Fehler sind schwer zu finden, da sie keiner Systematik folgen. Lapp hat sich daher zum Ziel gesetzt, die physikalischen Kopplungsmechanismen innerhalb von Motor-Anschlussleitungen zu untersuchen und daraus eine neuartige Kabelkonstruktion abzuleiten. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist die ZeroCM-Technik. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Verseilung: Drei Phasenleiter sind symmetrisch angeordnet und in einer Innenlage verseilt. Ergänzend wird mindestens ein Schutzleiter in einer Außenlage mit entgegengesetzter Verseilschlagrichtung um die drei Phasenleiter in einem bestimmten Schlaglängenverhältnis verseilt. Die Isolation der Leiter ist kapazitätsoptimiert und besteht aus Polyethylen, Polypropylen oder aus einer geschäumten Variante. Zwischen der Innenlage und der Außenlage befindet sich ein trennendes Fleece. Durch diese Konstruktion erreicht man perfekte elektrische Symmetrie, welche die magnetische Abstrahlung reduziert und die internen Kopplungen stark verringert. Die EMV-optimierte Kabelkonstruktion ist leicht umsetzbar und bietet den besten Schutz vor EMV-bedingten Störströmen. Ursprung der Innovation war es, den Status-Quo in der Kabeltechnik auf den Prüfstand zu stellen: so waren bisherige Konstruktionen eher auf geringe Außendurchmesser und eine optische Symmetrie getrimmt. Das Problem EMV wurde bis dato immer durch Schirmung gelöst. Lapp geht mit der ZeroCM-Technik einen anderen Weg: die Leitung ist vom visuellen Erscheinungsbild unsymmetrisch, jedoch wird 100 Prozent elektromagnetische Symmetrie erzielt und kommt dadurch sogar mit weniger Schirmung aus. Die Wirksamkeit der neuartigen Leitung wurde im Rahmen des Pepa-Projekts auch beim Versuchsaufbau bei dem Projektpartner SEW-Eurodrive bestätigt. Neben der Untersuchung einer EMV-optimierten Installation von Komponenten wurde unter anderem die Rolle der Ausgangsleitung bewertet. Zum Vergleich wurden ein identischer Versuchsaufbau mit einem Antriebssystem mit Potentialausgleich sowie paralleler Signalleitung (Profinet) gewählt. Verglichen wurden eine geschirmte PVC-isolierte Standardleitung, eine niederkapazitive Servoleitung, eine symmetrische Motorleitung mit drei Schutzleitern sowie die neuartige ZeroCM-Leitung mit optimiertem Aufbau. Die besten Werte hinsichtlich Ableitstrom am Umrichter-Ausgang wurden durch den kapazitätsarmen Aufbau der ZeroCM-Leitung erreicht. Die generierten Ableitströme stellen eine zusätzliche Belastung für den Frequenzumrichter und alle beteiligten Komponenten dar und sollten daher so gering wie möglich gehalten werden. Weiterhin wurde der über eine parallel liegende Signalleitung fließende Störstrom untersucht: Auch hier begünstigt der Einsatz der ZeroCM-Leitung die Ausprägung von möglichst geringen Störströmen. Aus den Untersuchungen bei SEW ergaben sich darüber hinaus Empfehlungen für die EMV-gerechte Installation von Frequenzumrichtern, wie beispielsweise ein niederimpedanter, HF-tauglicher und ein durchgängiger Potentialausgleich zwischen Frequenzumrichter und Antrieb. Eine wesentliche Bedeutung kommt hierbei dem Schirmanschluss mit EMV-gerechten Steckern oder flächiger Schirmauflage zu. Zusammengefasst beseitigt die Technik zwar nicht die Ursache von EMV-Störungen, adressiert jedoch genau eine der signifikanten Stellen, an der Störungen in das Systemumfeld eingebracht werden. Einerseits ermöglicht der neuartige Kabelaufbau um bis zu 80 Prozent reduzierte Ausgleichsströme am Frequenzumrichter-Ausgang und auf parallelen Pfaden wie beispielsweise Datenleitungen. Andererseits sorgen reduzierte Kabel-Umladeströme (cable-charging current) für verringerte Last am und im Umrichter selbst: So können beispielsweise längere Kabellängen verlegt werden, ohne dass der Frequenzumrichter außerhalb seiner (EMV-) Spezifikation betrieben wird. Zudem unterbindet die zeroCM-Technik das Entstehen von Spannungspegeln auf dem Masse-/Erdpotential (Ground-Voltage) auf der Verbraucherseite. Dies ist besonders wichtig, wenn beispielsweise empfindliche Sensorik wie Analoggeber zum Einsatz kommen. Neben den beschriebenen Vorteilen können Kosten eingespart werden, weil auf aufwändige Filtertechnik verzichtet werden kann und die Anlage stabiler läuft. Lapp will nun ein Portfolio mit der ZeroCM-Technik ausstatten; als nächstes sind Hybridleitungen im Fokus. Hybridleitungen, Sammelleitungen oder One-Cable-Solutions beinhalten neben den Leistungsadern auch Daten-, Resolver-, oder Steueraderpaare, welche bisher aufwendig von den Leistungsadern abgeschirmt wurden.
Drei Fragen an Ralf Moebus, Leiter Produktmanagement Industrial Communication bei Lapp

In welchen Branchen kommt es besonders häufig zu EMV-Störeinflüssen und durch was werden sie verursacht?
Ralf Moebus: Typischerweise treten EMV-Störeinflüsse besonders in solchen Bereichen der Fertigungsindustrie auf, in denen es einen hohen Automatisierungsgrad gibt. Beispielhaft steht hierfür die Automobilbranche, in der, etwa in Form von Schweißrobotern, sehr viele Servoachsen in Bewegung sind, oder die Nahrungsmittelindustrie, in der zahlreiche Verpackungsmaschinen im Einsatz sind. Natürlich treten auch im Schaltschrank häufig EMV-Störungen auf, verursacht z.B. durch Frequenzumrichter oder Netzteile.
Wie machen sich diese Störungen konkret bemerkbar?
Die Störungen machen sich vornehmlich an Datenleitungen bemerkbar, die in einem Fertigungsbetrieb Datenpakete zum Beispiel von einem Remote-I/O oder Sensor an eine SPS übermitteln sollen. Unterbleibt die Versorgung der SPS mit Daten für eine bestimmte Zeit, kann dies schlimmstenfalls zum kompletten Anlagenausfall führen. Die Steuerungen sind zwar in der Regel so ausgelegt, dass einmal ein paar Datenpakete verloren gehen dürfen. Wenn aber zu viele fehlen, stoppt die SPS den Produktionsprozess und es kommt zur Störung. Vor allem in der Automobilindustrie, aber auch in anderen Branchen kann ein solcher Ausfall enorme Kosten nach sich ziehen. Wenn nun ein Gabelstapler über eine Leitung fährt und diese beschädigt, ist die Ursache schnell ermittelt. Bei einer durch EMV-Einflüsse verursachten Störung kann die Fehlersuche aber mitunter sehr mühselig und aufwendig sein. Daher bietet Lapp für die Überwachung der Netzwerktechnik in einem Unternehmen eine neue Dienstleistung an, den sogenannten Health Check Service (siehe auch SPS-MAGAZIN 9/22, Seite 53ff., Anm. der Redaktion).
Wie versiert sind Ihre Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau in Bezug auf das Thema EMV-Störungen?
In aller Regel sind sich unsere Kunden bei der Planung ihrer Anlagen der EMV-Problematik durchaus bewusst. Die Fehler treten meist bei der Installation der Anlage beim Betreiber auf, weil diese nicht selten durch Personal erfolgt, das möglicherweise dahingehend nicht ausreichend ausgebildet ist. Wenn hier die Vorgaben des Elektroplaners nicht so umgesetzt werden, wie dies eigentlich nötig wäre, kann dies zu Problemen führen.